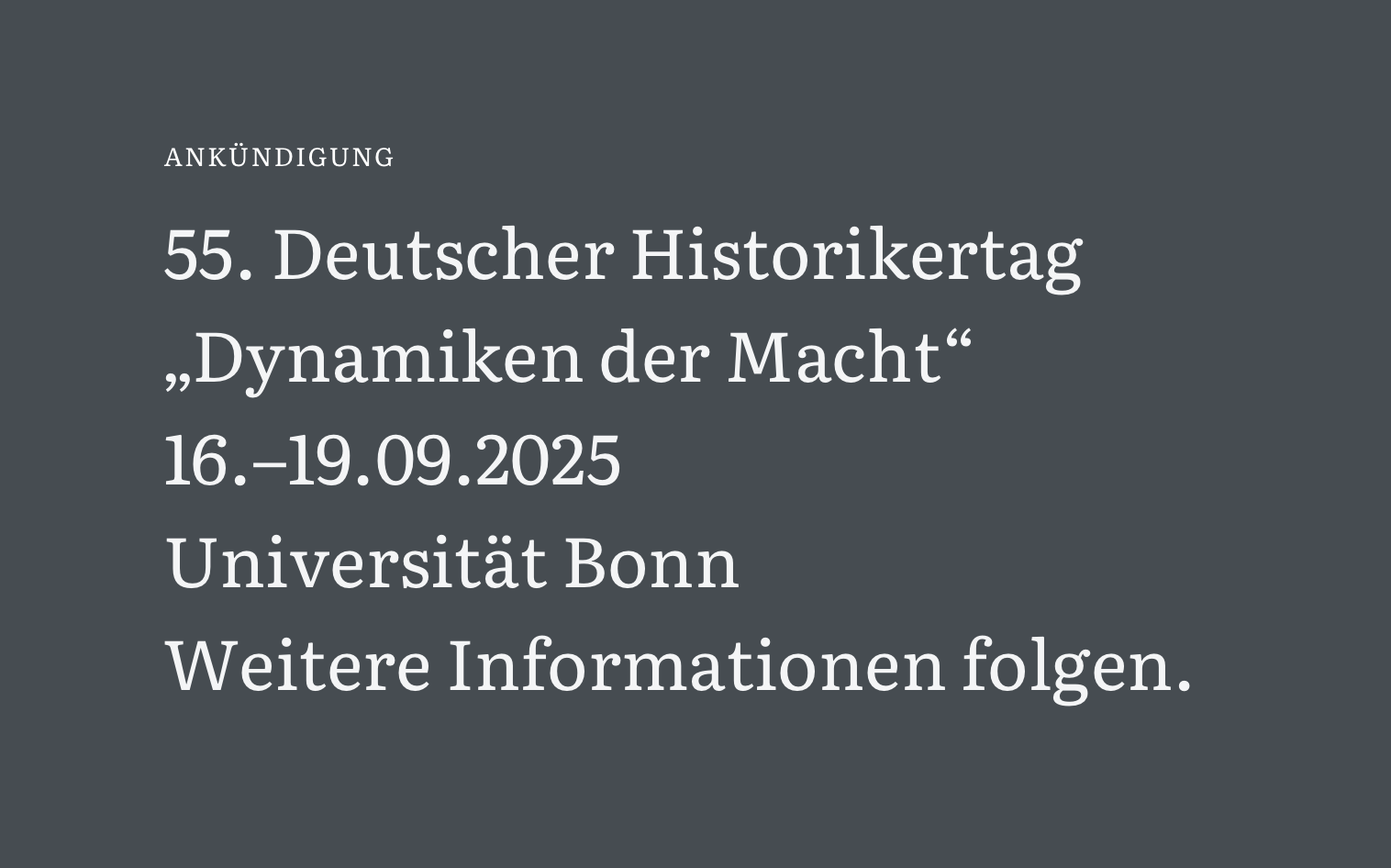Unsichere Urgeschichte – fragiles Wissen und die Hervorbringung der Tiefenzeit
Abstract
Die Suche nach Ursprüngen wurde im 19. Jhdt. besonders ‚aktuell‘: Nach der Destabilisierung religiöser Weltbilder und der Entdeckung der geologischen ‚Tiefenzeit‘ setzte in den 1830er Jahren eine Verwissenschaftlichung der Frage nach Alter und Entwicklung der Erde, des Lebens und der Menschheit vor dem Beginn schriftlicher Überlieferung ein. Die Dimensionen der ‚prähistorischen Tiefenzeit‘ waren anfangs noch nicht abzusehen: Neuen Disziplinen wie der Paläontologie, Paläoanthropologie oder der Ur- und Frühgeschichte standen für diesen Zeitraum keine schriftlichen Dokumente zur Verfügung, die Auskunft über ,Fakten‘ hätten eben können. Diese mussten erst einmal geschaffen werden, waren und sind jedoch schon deshalb ,fragil‘. Fragil sind die Quellen selbst. Artefakte, Funde und Befunde sind spärlich, fragmentarisch erhalten, werden bei ihrer Bergung beschädigt oder gehen später wieder verloren und müssen häufig in einem aufwändigen Prozess erst rekonstruiert werden. Fragil ist aber vor allem ihre Interpretation: Authentizität, Alter und Aussagekraft waren besonders im 19. Jahrhundert heftig umstritten. Und doch wurden und werden bis heute auf dieser Quellenbasis Thesen mit weitreichenden wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Implikationen formuliert. Wissen über die Urgeschichte dient seit dem 19. Jahrhundert als normative Argumentationsressource über den ,natürlichen‘ Charakter und die Lebensumstände des Menschen, als Projektionsfläche aktueller Gesellschaftsentwürfe oder als Abgrenzungsfolie zwischen ,Kultur‘ und ,Natur‘, ‚Zivilisation‘ und ‚Primitivität‘.
Die Sektion blickt auf Forschungen und Debatten über prähistorische Vergangenheiten von den 1830er Jahren bis heute: Wie gingen Zeitgenoss:innen in verschiedenen Kontexten mit Unsicherheit, Fragilität und Ambivalenz von Wissen über die Urgeschichte um? Welche Verifikationsstrategien, Erzählmuster und Methoden entwickelten sie, um (scheinbare) Eindeutigkeit und Stabilität zu erzeugen? Und welche Ziele waren damit verbunden?
Der Beitrag befasst sich mit der Entdeckung, Erforschung und taxonomischen Klassifizierung von Sauriern. Diese wertet er als bedeutenden Einschnitt der Wissenschaftsgeschichte und wichtige Etappe für die Durchsetzung eines auf der Evolutionslehre basierenden Weltbilds, wobei bis weit ins 20. Jahrhundert hinein darwinistische mit lamarckistischen und religiösen Deutungen koexistierten und verschränkt wurden. Angesichts der fragmentarischen und nur durch überzeitliche Analogieschlüsse zu interpretierenden fossilen Überlieferung griffen paläontologische Forschung, künstlerische Imagination und populärkulturelle Aneignung bei der Rekonstruktion der Saurier und ihrer Lebensweise von Beginn eng ineinander und beeinflussten sich wechselseitig.
Der Beitrag thematisiert, wie der Paläobiologe Franz Unger in Zusammenarbeit mit den Landschaftsmalern Joseph Kuwasseg und Joseph Selleny in den Jahren 1845–1868 in immer wieder neuen Anläufen versucht, der fragilen Quellenlage zum Trotz ein ,geologisches Bild‘ vom Urmenschen zu entwerfen. Er zeigt, wie der Urmensch dabei auf der geologischen Zeitskala immer tiefer verortet wird, dass es zur Hervorbringung der Urgeschichte neben dem Ausgraben, Ordnen, Vergleichen und Rekonstruieren auch des Reisens und Zeichnens bedarf, und dass die Leerstellen, die für die Öffentlichkeit entworfene Bilder noch aufweisen, in Bildern zum privaten Gebrauch bereits gefüllt werden.
Der Beitrag untersucht die Ambivalenz der Analogiebildung in der prähistorischen Forschung, indem er rekonstruiert, wie Mitte des 19. Jahrhunderts eine europäische Steinzeit der Pfahlbauten anhand lokaler archäologischer Artefakte, vor allem aber durch Vergleiche mit zeitgenössischen überseeischen Menschen ,erfunden‘ wird: Gezeigt wird, wie Akteure der Altertumskunde, Pazifikexploration, Naturforschung und Paläontologie der fragilen Faktenlage der ersten Epoche der Menschheitsgeschichte eine Imagination von Steinzeit entgegensetzen, die abgesichert durch die wissenschaftliche Analogiebildung als exotische Vorstellung von tiefer Vergangenheit angeeignet, popularisiert sowie zugleich als Lebensweise zur chronopolitischen Kategorie von entwicklungs- und zivilisationstheoretischer Differenz werden kann.
Der Beitrag befasst sich mit der politischen Instrumentalisierung von fragilen Fakten über die Urgeschichte. Angehörige indigener Gruppen betonen besonders in Nordamerika, dass ihre Vorfahren seit prähistorischer Zeit im Einklang mit der Natur gelebt hätten und erst deren Kolonisierung die Ausrottung von Tierarten und die Zerstörung von Lebensräumen zur Folge gehabt habe. Diese These ist jedoch stark umstritten, wobei sich wissenschaftliche und politische Debatten überlagern. Der Vortrag beleuchtet diesen Themenkomplex am Beispiel der Diskussion um den ‚pleistozänen Overkill‘, in der seit den 1970er Jahren darüber gestritten wird, ob das Massenaussterben der eiszeitlichen Megafauna vor ca. 12 000 Jahren von klimatischen Faktoren oder durch die Ankunft der ersten Menschen auf dem Kontinent verursacht wurde.
Die Quellen der Urgeschichtsforschung bestehen ausschließlich aus Überresten der materiellen Kultur. Auf den ersten Blick scheint ihnen ihre Materialität Eindeutigkeit zu verleihen; deshalb heißt es immer wieder ‚Funde erzählen Geschichte‘. Tatsächlich jedoch sind archäologische Quellen vieldeutig und müssen über Analogieschlüsse interpretiert werden, bei denen Unbekanntes mit Bekanntem gedeutet wird. Die Geschichten, die Funde angeblich erzählen, gründen folglich im Erfahrungshintergrund der Forschenden. Damit die Urgeschichte nicht zur Projektionsfläche für aktuelle Konzepte wird, ist es notwendig, dem spezifischen Charakter archäologischer Quellen Rechnung zu tragen: Je selbstreflexiver und vernetzter die Wissenskonstruktion erfolgt, desto valider sind die Geschichten, die mit den Quellen erzählt werden.