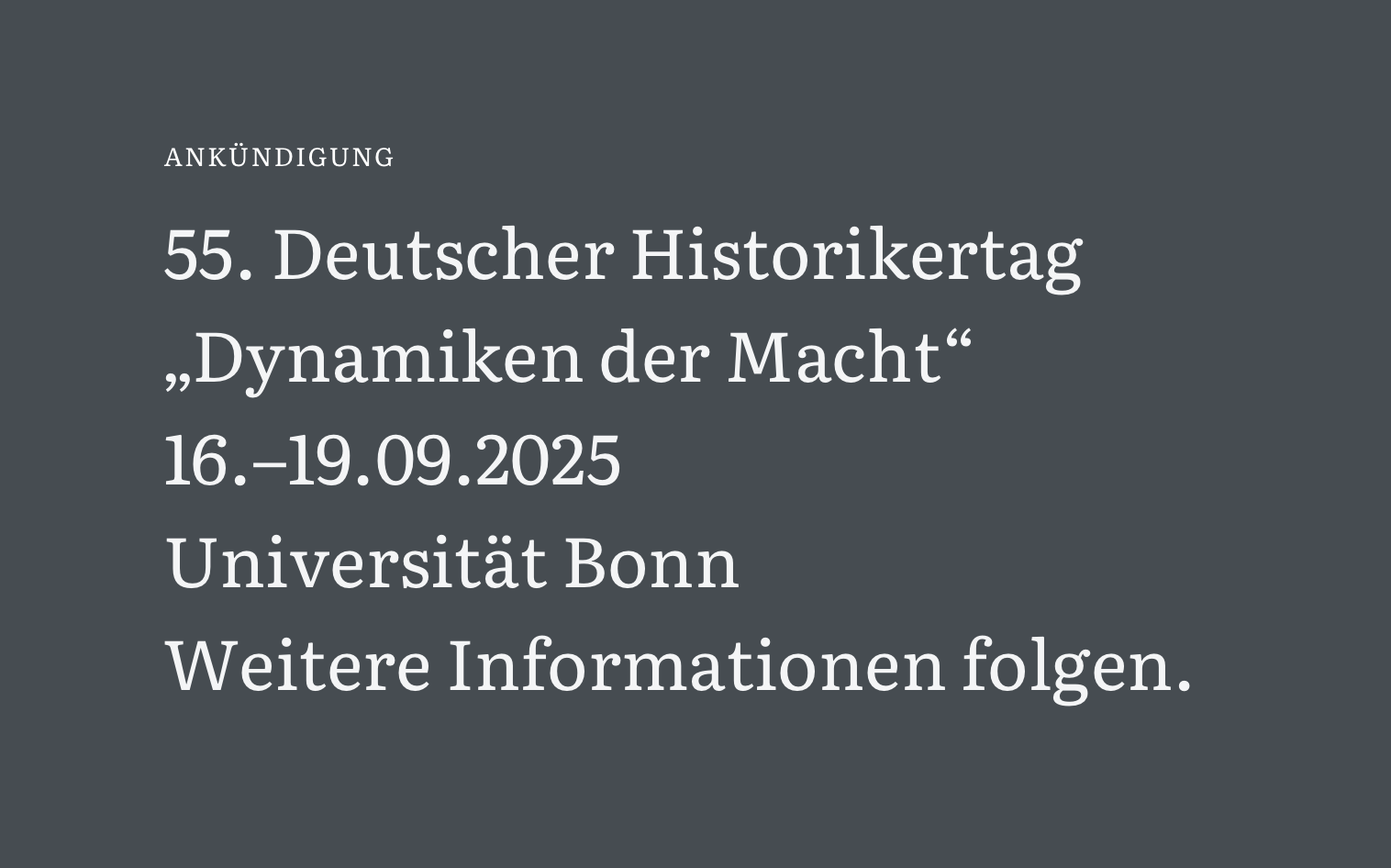Krieg und Körper. Verletzbarkeit und Körperkonzepte im Wandel, 1500-1940
Abstract
Was macht der Krieg mit dem Körper? Und wie beeinflussen Körperlichkeit und Vorstellungen vom Körper den Krieg? Die Sektion untersucht die Wechselwirkungen zwischen Krieg und Körper aus einer epochenübergreifenden Perspektive.
Frühneuzeitliche Körperkonzepte unterschieden sich von modernen vor allem durch die Durchlässigkeit und Porosität der Grenze zwischen Innen und Außen. Geist, Seele und Körper schienen untrennbar miteinander verwoben. Medizinhistorische Arbeiten konnten zeigen, wie Krankheit in der Vormoderne zwar im Körper verankert, dabei aber oftmals als Manifestation von sozialen Konflikten oder spirituellen Prüfungen erlebt wurde. Eine analytische Trennung von körperlichen und psychischen Pathologien begann erst in der Aufklärung als sinnvoll zu erscheinen, blieb aber weiterhin unscharf.
Im Krieg sind Körper Ressourcen des Kampfes, Orte von Erfahrung, Medien der Gewalt und Objekte der Disziplinierung. Sie sind dabei fundamental geprägt durch ihre Verletzbarkeit. Der Krieg formt den Körper und er kann ihn zerstören. Im Laufe der Neuzeit wurden soldatische Körper mehr und mehr diszipliniert. Ideale männlicher, durch Drill geformter Körperlichkeit wurden spätestens in den Napoleonischen Kriegen immer wichtiger. Körper waren das Kapital von Kriegsmännern und wurden verkauft, aber sie wurden auch mehr und mehr zu etwas, dessen Einsatz der Staat Männern abverlangte. Wenn jedoch der Körper nicht mehr mitspielte, zog er eine Grenze, die Akteure wiederum für sich nutzen konnten. Verletzbarkeit begründete mitunter auch Widerstand und Resilienz.
Die Sektion fragt danach, inwieweit Erfahrungen von Kriegsgewalt und der Umgang mit Verletzungen von unterschiedlichen Konzeptualisierungen des Körpers abhing. Dabei spannen die Vorträge den Bogen vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Sie fragen nach Kontinuität und Wandel im Verhältnis von Krieg und Körper und stellen damit auch die Epochengrenze Vormoderne/Moderne zur Diskussion.
Soldaten des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts waren nur dann ihr Geld wert, wenn sie kampffähig waren. Gleichzeitig, so zeigen rezente archäologische Befunde, waren sie körperlich oft schwer beeinträchtigt. Das Paper geht der Frage nach, welchen Blick Soldaten auf die Verletzlichkeit des eigenen Körper hatten, wie sie mit dem Risiko ihres Berufs umgingen und ob sie die ‚typische‘ Verwundung im Kampf anders bewerteten als die statistisch weitaus bedrohlichere Gefahr durch Krankheit, Hunger und Wetter.
Im Zusammenhang des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) und den damit verbundenen Rekrutierungsproblemen entwickelte sich in der Habsburgermonarchie ein Diskurs über sogenannte «Mutilanten». Der Begriff bezeichnete Männer, die sich selbst verletzt hatten, um dem Kriegsdienst zu entkommen. Zeitgleich bemühte sich die kaiserliche Regierung, «Invaliden» als ehrenvolle Männer aufzuwerten. Im Krieg verletzte Körper wurden im ersten Fall zu Zeichen «unmännlicher Zaghaftigkeit», im zweiten zum Ausdruck von «männlichem Mut» und Opferbereitschaft. Das Paper fragt danach, wie diese Grenzen um Körper und Männlichkeit gezogen wurden und welche Konsequenzen sie für die Betroffenen hatten.
Die Gewalt des Ersten Weltkriegs zeitigte unter Soldaten mit neuen Dimensionen der Angst auch bis dahin weitgehend unbekannte körperliche Reaktionen: die ‚Kriegsneurose‘ bzw. ‚Kriegshysterie‘. Diese Leiden wurden vielfach von Traumerscheinungen begleitet, die die noch junge Psychoanalyse veranlassten, ihre Auffassung vom Traum als Wunscherfüllung einer kritischen Reflexion zu unterziehen. Der Vortrag fragt nach der Bedeutung des Körpers in Traumerzählungen des Ersten Weltkriegs und nach seiner Relevanz für die Traumdeutung der Zeit. Dabei nimmt er auch die von Zeitgenossen beobachtete Wiederbelebung frühneuzeitlicher Vorstellungen von prophetischem Träumen in den Blick.
In stories about military training in the modern era, the male body has been an object of disciplinary regulation, but also a site personal experiences of both shame and pride, of both humiliation and proving one’s worth. With a focus on corporeality, this paper analyses a body of memory narratives recorded in the 1970s concerning conscripted military training in interwar Finland, 1919–1939. Three topics are discussed: ”hardening” the male military body, masculine pride in physical endurance, as well as the body as a site of resistance. Memory narratives, this paper argues, are a rich yet complex source material for accessing men’s understandings and narrations of corporeality, at the intersection of cultural discourses on men’s bodies and men’s subjective bodily experiences.