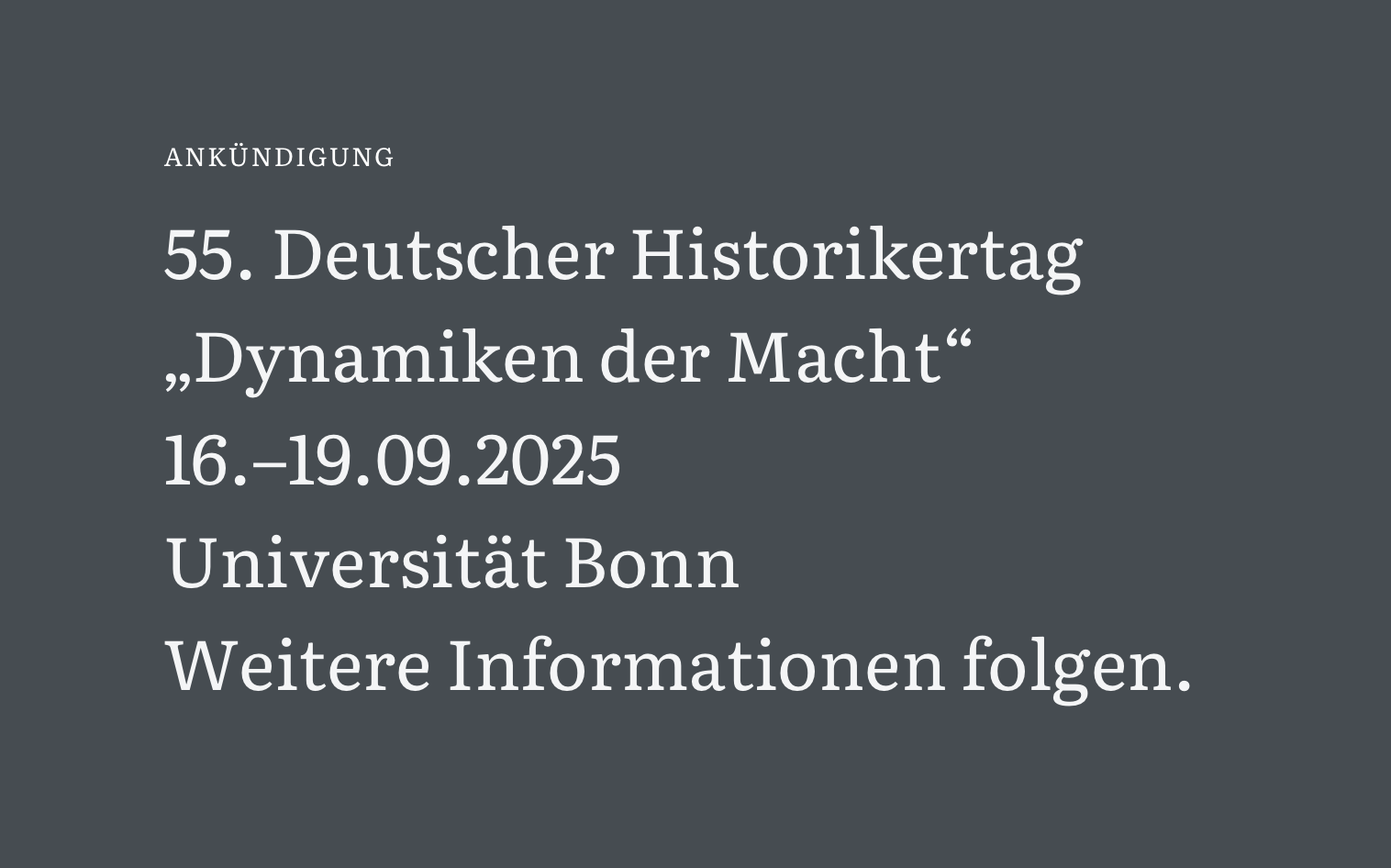Die Konstruktion antijüdischer „Fakten“: Die Sprache des Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert
Abstract
Die intellektuelle Arbeit, Geschichte zu verstehen, zu erklären und zu schreiben, ist mit Sprachen – im Plural – auch dann konfrontiert, wenn es sich um ein Thema handelt, das im Rahmen der eigenen Muttersprache angesiedelt ist. „Je tiefer wir in vergangene Zeiten zurückgehen“, so formulierte dies Hans-Jürgen Goertz in seiner Einführung in die Geschichtstheorie (1995), „desto mehr Sprachwelten müssen wir durchschreiten und Übersetzungsarbeit leisten.“ Die Sektion „Die Konstruktion antijüdischer ‚Fakten‘: Die Sprache des Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert“ nimmt die geschichtstheoretische Annahme ernst, dass alle Geschichtserkenntnis auch ein Übersetzungsvorgang von einem Damals in ein Heute ist und dass dafür eine einzige Sprache nicht ausreicht. Dies gilt insbesondere für den Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, weil dieser Sprachformeln und Begriffe regelrecht als Waffen einsetzt. An seinem Beispiel werden in den Vorträgen zwei Aspekte der sprachlichen und historiographischen Übersetzungsarbeit vorgestellt und diskutiert, die stets zusammengehören: Thema ist einmal die Analyse der sprachlichen Struktur antisemitischer Anfeindungen selbst, seine Wort- und Metaphernwahl, seine aporetischen Denkfiguren, die Praxis des Double-Binds und der Wiederholungen sowie die Diskurslogik im Allgemeinen (etwa die Verwissenschaftlichung des Ressentiments durch Fremdworte und die Angleichungen an den akademischen Jargon u.a.); sodann machen die Vorträge auch jene widerständigen Versuche zum Thema, den sprachlichen Auffälligkeiten antisemitischer Diffamierungs- und Ausgrenzungsideologie selbst mit Mitteln der historischen Sprachkritik entgegenzutreten und sie sprachlich-gedanklich zu dekonstruieren. Das Panel bietet somit exemplarische Einsichten in den historiographischen Gebrauch von Metaphern, Begriffen und Terminologien an, die im Prozess der Übersetzungs- und Erkenntnisarbeit zu ganz unterschiedlichen Zeiten auf sehr verschiedene Art und Weise praktiziert wurden, um dem Antisemitismus mit Sprachbewusstsein entgegenzutreten.
Kollektivsingulare sind auf der grammatischen Ebene formökonomische Werkzeuge, die das/den Einzelne/n als Allgemeines setzen: ‚Der Jude‘, ‚die Geschichte‘, ‚der historische Prozess‘. Mit Reinhart Koselleck und Niklas Luhmann sind sie Zeichen einer Übergangssemantik um 1800, die Irritationen abfängt und Ausdifferenzierungen begleitet. Der Vortrag untersucht Kollektivsingulare als grammatische Lieblingsfiguren des Antisemitismus auf ihr intrikates Verhältnis von Singularisierungs- und Pluralisierungsbestreben und als Stilmittel und Sprachstrategie in Repliken auf die Sprache des Antisemitismus u.a. von Ludwig Börne und Heinrich Heine.
Es waren neue Sprachformeln, die den Essay „Unsere Aussichten“ von Heinrich von Treitschke 1879 so wirkungsvoll und erfolgreich machten: Mit Wendungen wie „fremdes Volkstum“ und „jüdischer Charakter“, der Wortprägung „deutsche Judenfrage“ und der scharfen Gegenüberstellung von „Deutschthum“ und „Semitenthum“ prägte der Berliner Historiker den judenfeindlichen Diskurs in Deutschland auf Jahrzehnte hinaus. Als der Kritiker Walter Boehlich 1965 mit seiner Dokumentation daran erinnerte, nahm er sich der Sache deshalb aus sprachkritischer Perspektive an. Der Vortrag zeigt auf, wie Boehlich versuchte, die Anfeindungsformeln des 19. Jahrhunderts mit den Mitteln sprachsoziologischer Argumente aus dem Thesaurus der deutschen Sprache zu exorzieren.
Der Vortrag untersucht den biologischen Begriff der „Mimikry“ im Diffamierungsvokabular des frühen 20. Jahrhunderts. An Texten des Nationalökonomen Werner Sombart, des Schriftstellers Ernst Blüher und des Juristen Carl Schmitt wird die strukturelle Paradoxie aufgezeigt, die die Fügung „jüdische Mimikry“ ausmacht und die auch zum Kern antisemitischer Verschwörungstheorie gehört: Juden, so wird insinuiert, passten sich „bis zur Unkenntlichkeit“ an die Gesellschaft an, bleiben aber dennoch erkennbar anders. Diesem feindseligen semantischen Hiatus war nicht zu entkommen. Die Stoßrichtung des „Mimikry“-Diskurses, so zeigt dieser Vortrag auf, liegt nicht in der vorgebrachten Anklage der Camouflage, sondern allein in der Unentrinnbarkeit negativer Zuschreibungen für die Betroffenen.
In der historischen Emotionsforschung wird das komplexe Verhältnis zwischen Emotionswörtern und Gefühlen erforscht. Die Konjunktur des Begriffs „Kollektivschuld“ in der unmittelbaren Nachkriegszeit verweist exemplarisch auf eine besondere Ambivalenz, denn was die Deutschen selbst gerade noch propagiert und praktiziert hatte – kollektiven Hass gegen Juden – wird nun, nach der Shoah, in einer aggressiven Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnis rhetorisch abgewehrt: die Massenverbrechen habe man nicht als Volk begangen, Schuld trügen nur Einzelne. Die empörte Zurückweisung des Gedankens kollektiver Verantwortlichkeit wurde so zu einem Mittel der Diskursverweigerung. Der Vortrag blickt sowohl auf Sprechakte der Schuldabwehr als auch auf den besonderen Hohlraum des Verschweigens, dem sie angehören. Die Sprache des Antisemitismus, so legt der Vortrag dar, ist nach 1945 nicht mehr bekennend, sondern verbleibt häufig im Unausgesprochenen oder in verschobenen, sekundären Diskursen.