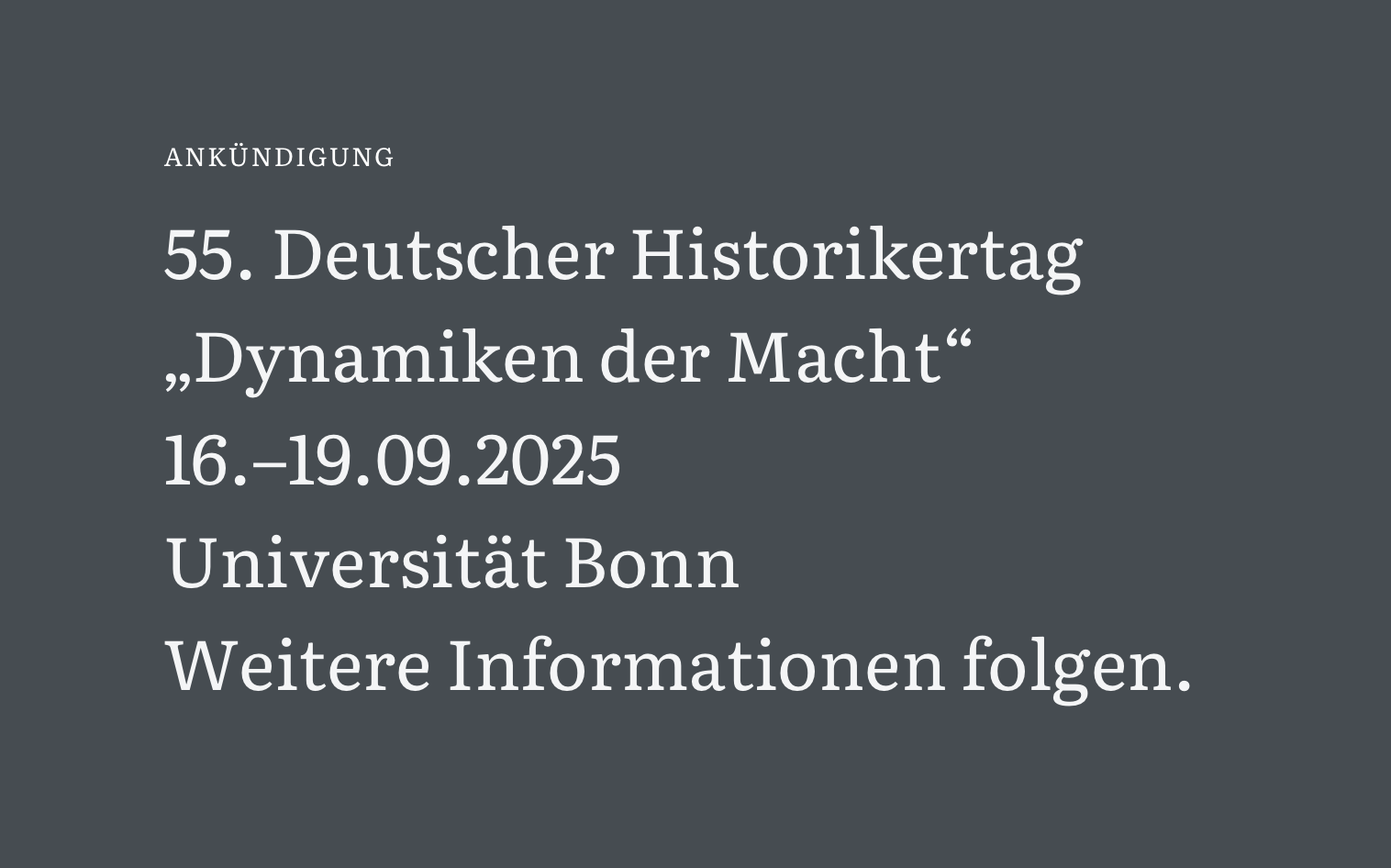Der umstrittene Leviathan. Staatlichkeit und Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland
Abstract
Zahlreiche Studien haben eindrücklich herausgearbeitet, dass Staatlichkeit und Streitkräfte in der Neuzeit untrennbar miteinander verbunden waren. Indes findet dieser Zusammenhang in der deutschen Zeitgeschichte, die lange Leitperspektiven wie Liberalisierung oder Zivilisierung folgte, kaum Berücksichtigung. Hier setzt die Sektion an und zeigt, dass das Militärische während des Ost-West-Konflikts ein prägendes Faktum in Politik, Gesellschaft und Kultur der Bundesrepublik bildete. Das Militär war insbesondere deshalb umstritten, weil es mit der NS-Vergangenheit verbunden wurde und seine Existenz dem Ideal der Gewaltabkehr entgegenlief. Zugleich wollten die politischen Entscheidungsträger nicht auf Streitkräfte verzichten, denn sie verkörperten nach wie vor Souveränität, die in Westdeutschland lange beschränkt war.
Anhand dieses Themas werden zentrale Probleme der deutschen Zeitgeschichte diskutiert. Sie wird in trans- und internationalen Bezügen betrachtet, um den nationalen Blick zu weiten. Anhand von fünf Fallstudien zeigt die Sektion, dass hegemoniale Vorstellungen von Ideen und Praktiken „des Staates“ sukzessive erodierten. Seine Legitimitätsansprüche und Aufgaben wurden zum Gegenstand eines Diskurses, der sich zwischen zwei Polen bewegte: Die bewaffnete Macht wurden einerseits als Zeichen staatlicher Souveränität und Sicherheit, andererseits als Bedrohung von Frieden und Demokratie begriffen. Insgesamt macht die Sektion deutlich, dass Forschungen zur Staatlichkeit die Streitkräfte einbeziehen sollten: Erstens, weil ihre die Umstrittenheit die demokratische Kultur wesentlich prägte; zweitens, weil Gewaltpotenziale auch nach 1945 Bestandteil von Staatlichkeit blieben. So eröffnet sich eine Perspektive, welche die Geschichte der Bundesrepublik nicht entlang eingefahrener Bahnen fortschreibt, sondern weiter pluralisiert.
Moderation: Heike Wieters (Berlin)
Die einführenden Bemerkungen verdeutlichen, dass das Militärische die deutsche Zeitgeschichte entscheidend mitgeprägt hat. Mit einem Blick auf die aktuelle Forschung wird gezeigt, wo es Desiderate gibt. Mit einem Fokus auf den Konnex von Staatlichkeit und Streitkräften lassen sich zentrale Probleme der deutschen Geschichte im internationalen Kontext untersuchen.
Mit ihrer Rekrutierung der militärischen Elite schuf sich die DDR ein Offizierkorps, in dem die politische Haltung gegenüber dem Einparteienstaat die Herausbildung eines komplexen Staatsverständnisses ersetzte. In der Bundesrepublik hingegen ließ die bedingte Elitenkontinuität die Generale an ein frühromantisches Staatsverständnis anknüpfen, in dem „der Staat“ zu einer Letztinstanz geworden war, dem auch der Herrscher unterworfen blieb. Insofern folgten sie Adenauers Westpolitik und der damit verbundenen Annahme der parlamentarischen Demokratie letztlich aus der Überzeugung, dass eine zwar integrierte, aber souveräne deutsche Staatlichkeit nur durch die Anlehnung an die USA möglich sein würde.
Thema sind die wechselseitigen Wahrnehmungen in der niederländischen und westdeutschen Gesellschaft und Öffentlichkeit im Hinblick auf die „Straßenschlachten“ in den 1970er Jahren. Proteste forderten in beiden Staaten das staatliche Gewaltmonopol unmittelbar heraus. Die Amsterdamer Polizei zog die niederländischen Streitkräfte zur Unterstützung hinzu, und setzte sogar Panzerfahrzeuge gegen Demonstranten ein. Westdeutsche und niederländische Beobachter zogen dabei neue Grenzen zwischen Staat und Opposition, wobei die Protestbewegung in den beiden Ländern zu unterschiedlichen politischen und parlamentarischen Rückschlüssen hinsichtlich der Bedeutung der Staatsgewalt führten.
Der Beitrag untersucht die Sicht des Bonner Verteidigungsministeriums (BMVg) auf „1968“. Er fragt, inwiefern Proteste und Störaktionen gegen die Bundeswehr als (il-)legitim wahrgenommen und welche Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. Als besonders gefährlich galten kommunistische Einflüsse aus der DDR sowie westeuropäische Kriegsdienstverweigerer-Netzwerke, die die Wehrbereitschaft der Soldaten zu untergraben drohten. Der Vortrag zeigt exemplarisch, wie sich „1968“ das Staats- und Demokratieverständnis in einer obersten Bundesbehörde wandelte.
Mein Referat blickt in einem asymmetrischen Vergleich mit den britischen Bewegungen gegen Nuklearwaffen (Campaign for Nuclear Disarmament, CND) auf die Vorstellungen von Staatlichkeit und Militär in Westdeutschland seit den 1950er Jahren. Es zeigt auf, wie sich in den Debatten der westdeutschen Friedensbewegungen eine viel größere Staatsskepsis als in Großbritannien offenbarte. Dieses „verletzte Staatsbürgertum“ (Michael Geyer) speiste sich aus den Erfahrungen und Erinnerungen an die Gewalt des Zweiten Weltkriegs. Anders als in Großbritannien implizierte das Sprechen über Staatsgewalt damit immer auch ein Sprechen über die von Deutschen verübte genozidale Gewalt des Zweiten Weltkriegs.
Dass das Militär für Hausbesetzer:innen der 1970/80er Jahre – in unterschiedlichster Weise – einen wichtigen Referenzpunkt darstellte, mag überraschen, richtete sich ihr Aktivismus doch vor allem gegen die staatliche Wohnungsmarktpolitik. Westdeutsche Hausbesetzer:innen rechtfertigten ihre Gewaltbereitschaft, indem sie ihren Protest als Widerstand gegen einen der NS-Vergangenheit verhafteten Militärstaat deuteten. Londoner Squatter indes stellten sich gern in die Tradition britischer Veteranen, definierten sich so als Teil der nationalen Gemeinschaft und appellierten an die staatliche Fürsorgepflicht. Hier zeigt sich, wie stark hier wie dort Staatlichkeit und Militär zusammengedacht wurden.